Yes, we Scan! Self-Scanning oder der Kunde ist der PoS.
Wir alle kennen wahrscheinlich das Problem: Samstagvormittag im Supermarkt des Vertrauens, der Wagen ist voll, die Einkäufe fürs Wochenende im Wagen, die Einkaufsliste abgehakt. Soweit noch alles in Ordnung. Solange bis es an die Kasse geht. Dort angelangt stellen wir fest, dass wir (wie an jedem Wochenende zuvor auch) nicht die einzigen waren, die auf die glorreiche Idee gekommen sind, den Wocheneinkauf auf den Samstagvormittag zu legen. Die Folge? Lange Schlangen an den Kassen, zunehmend genervte Gesichter, gestresste Kassierer/-innen, ungeduldiges Gerangel mit den Einkaufswagen – Business as Usual. Dieselbe Szene in London, England: In einem nicht näher benannten Supermarkt gehen genauso viele Leute einkaufen, doch die Schlangen sind bedeutend kürzer. Was war geschehen? Kleinere Warenkörbe? Schwarze Löcher, die Kunden mitsamt Wagen aufsaugen und hinter der Kasse wieder ausspucken? Nicht ganz: Anderswo setzt man heute nur schon vermehrt auf Self-Scanning.
Self-Checkout bei den Schweden
Dieses Anderswo gibt es auch bei uns in Deutschland – wann waren Sie das letzte Mal schwedische Möbel einkaufen? Dann kennen Sie die Self-Checkout-Kassen bereits. Hat man den Dreh einmal raus, geht alles ganz einfach – und vor allem schnell. Dass dieser Gewinn an Geschwindigkeit nicht alleine auf dem Servicegedanken des Unternehmers gründet, dürfte klar sein.
Schnellere Durchlaufzeiten bedeuten mehr Kundendurchsatz bei weniger Personaleinsatz gleich eingesparte Personalkosten. Bei angenommenen 30 Sekunden pro Kassiervorgang und 0,5 Cent Personalkosten pro Sekunde ergibt sich das kalkulatorische Potenzial nicht erst bei 2,5 Milliarden Kassiervorgängen pro Jahr (geschätzte Angaben des jährlichen Aufkommens beim Branchenführer EDEKA). So far, so good, sagt der Engländer. Så långt, så väl der Schwede.
Kaufabbruch wegen Warteschlangen
In Deutschland steht man lieber in der Schlange (abgesehen von einigen Pilotprojekten vereinzelter Lebensmittelketten mit dedizierten Geräten). Der große Durchbruch lässt leider noch auf sich warten. Wobei der Leidensdruck vorhanden wäre: Laut einer Studie von Epson aus dem Jahr 2014 haben bereits 29% der Befragten einen Laden aufgrund von Warteschlangen verlassen und den Kauf abgebrochen.
Die Vorteile liegen kundenseitig auf der Hand: Selbst gescannt bedeutet Komfortgewinn. Bislang wird jeder Artikel der gekauft wird, vom Kunden mindestens vier Mal in die Hand genommen: Vom Regal in den Wagen, vom Wagen aufs Band, vom Band in den Wagen und vom Wagen in die Tüte. Da kommt was zusammen, denken Sie nur einmal an Ihren Wochenendeinkauf!
„Grab’n’go“ statt „One-Click-Shopping“
Im Internet ist „one-click-shopping“ seit Jahren etablierte Praxis. Der brick-and-mortar Handel zetert über Kundenabwanderung, ist aber von einem Vergleichbaren „grab’n‘go“ noch (sehr) weit entfernt. Zugegeben, es liegt nicht nur an der Lethargie und Innovationsunlust der Kaufleute. Moderne Self-Checkout-Kassen reißen immerhin ein fünf-stelliges Loch ins Budget. Das ist selbst für experimentierfreudige Mittelständler keine kleine Hürde. Mobile Handscanner, genau genommen MDE Geräte mit einer Benutzeroberfläche für Endkunden, sind pro Stück zwar billiger – bei mindestens 20 Geräten, die pro Markt vorgehalten werden müssen, steigen die Kosten für das Gesamtsystem aber dennoch schnell wieder über 20.000 €.
Wird die Anschaffung trotzdem gewagt, kommt die eigentliche Herausforderung: Wie bekommt man den Kunden dazu, die Geräte zu nutzen und zu erkennen, dass sein Leben damit leichter wird? Für die Bedienung eines mobilen Handscanner braucht es zwar kein abgeschlossenes Ingenieursstudium, eine Hürde ist der Einstieg und die Nutzung eines fremden Geräts aber dennoch, wie aktuelle Akzeptanz-Studien zeigen.
„Bring Your Own Device“ im Einzelhandel
Es gibt inzwischen Lösungen, die genau an diesem Punkt ansetzen und „BYOD (Bring Your Own Device)“ als Konzept propagieren: Smartphones sind seit mindestens zwei Jahren performant genug, um die Aufgabe eines Scanners zu übernehmen und sie haben den unschätzbaren Vorteil, dass der Kunde sie kennt. Es ist das EIGENE Gerät und dem wird vertraut.
Blickt man über die Landesgrenzen, findet man bereits häufiger die Möglichkeit mit seinem mobilen Gerät einzukaufen. In der Schweiz sind z.B. die MIGROS oder COOP Vorreiter. Ticken die Schweizer so anders als wir? Wieso funktioniert mobiles Self-Scanning dort, aber hier nicht?
Sind es die Barrieren im Kopf von Entscheidern oder ist es Max Mustermann der sagt “Wieso sollte ich die Waren selbst einscannen, dann übernehme ich ja die Arbeit der Kassiererin?” Oder sind es Berater von Consulting Firmen, die seit ihrem Studienende nur „besser wissen“, aber noch nie auch nur zehn Minuten an einer Kasse saßen? Die jetzt die Erfahrung der letzten Jahre einfach fortschreiben und von einem „typisch deutschen Akzeptanzproblem“ reden? Die einfach übersehen, dass ein Dispenser (= Aus- und Abgabestelle) für die mobilen Scanner neben den Einkaufswägen stehen muss und nicht zwischen Leergutannahme und Kundentoiletten, weil dort am meisten Platz ist?
Gefühlte Wartezeit ist länger
Das „Selber-machen“ ist nicht das Problem, sonst hätten wir in Deutschland noch Tante Emma und den freundlichen Tankwart. Aber der Kunde möchte abgeholt werden. Mit einer bekannten Technologie, die einfach und intuitiv verständlich ist und deren Mehrwert im Alltag – ohne Stoppuhr – erlebt wird.
Um wieviel Zeit es geht wird spätestens dann klar, wenn man ein erstes Mal hinter jemand stand, der seinen Einkauf selbst erfasst hat. Der ist nämlich schon fertig mit Bezahlen und draußen, bevor man auch nur seine Waren aufs Band gelegt hat.
Überlegungen wie die Frage, ob die an der Kasse durch Self-Scanning gewonnene Zeit nicht beim Selbst-Scannen am Regal zuvor verloren ging, sind akademisch: Die Zeit, die wir in der Kassenschlange stehen, zählt gefühlt mindestens doppelt. Glauben Sie nicht? Dann fragen Sie doch mal die Mutter mit drei Kindern und vollem Einkaufswagen ganz hinten in der Schlange an besagtem Samstagvormittag.
Mehrwerte durch Self-Scanning
Der Nutzen von Self-Scanning muss nicht bei der Zeitersparnis enden. Bereits heute zeigen Lösungen auf Smartphone-Basis dem Kunden auch die Inhaltsstoffe des gescannten Produkts. Manche Self-Scanning-App bringt beispielsweise zusätzlich auch Warnhinweise, wenn beim Erdnussallergiker doch ein Produkt mit „Spuren von Nüssen“ im Einkaufswagen landet. Auf Wunsch kennt sie auch das Zauberwort Cross-Selling und empfiehlt den passenden Käse zum Bordeaux.
Ware selbst einscannen ist ja nicht neu: Auch die Wege wie man den Einkauf dennoch kontrolliert sind bekannt und akzeptiert. Doch echte Relevanz für den Kunden entsteht heute erst mit Ort und Zeit der Ansprache und gerade das ist das Revolutionäre: Bei den vorherrschenden, stationären Ansätzen hat der Kunde seinen Einkauf bereits abgeschlossen, bezahlt und verlässt gerade den Laden. Das Maximum an Interaktion ist ein Coupon auf der Rückseite des Kassenzettels, mit dem der nächste Besuch vorbereitet wird. Die mobilen Lösungen beenden diese Einschränkung und eröffnen den Marketeers ein riesiges Potenzial an Möglichkeiten, die daraus resultieren, dass der Kunde während des Einkaufs erreichbar und damit zugänglich für Vorschläge ist.
Aus der laufenden Warenkorbanalyse ergibt sich der Inhalt des Vorschlags in Echtzeit. Wenn Babybrei und Haferflocken bereits im Wagen sind, ist der Tipp zur Familienpackung Windeln naheliegend. Dass die Entwickler der Algorithmen aus dem Schalldruck des quengelnden Nachwuchses auch schon Vorschläge für die Spirituosenabteilung ableiten, wollte der Hersteller dagegen nicht bestätigen.
Couponing by Marktradio
Die Möglichkeiten der Kundenansprache sind nicht auf die Ware und EAN Codes begrenzt. Derzeit erproben Instore-Radio-Anbieter bereits Couponing über einen weiteren Kanal. Die Marktlautsprecher werden genutzt, um zusätzlich unhörbare akustische Signale auszuspielen, die als Coupons oder Promotion-Codes auf den Smartphones der Kunden ankommen. Der “Persil – heute 2 für 1” Aufsteller hat damit in absehbarer Zeit ausgedient, denn die entsprechenden Hinweise kommen nun vom Marktradio direkt aufs Kundensmartphone.
Das hat den Charme, dass die vorhandene Infrastruktur besser genutzt wird und keine Investitionen z.B. für Beacons anfallen, mit denen heute ähnliche Funktionen realisiert werden. „Couponing by Marktradio“ gibt den Marketeers eine bisher unbekannte Flexibilität, denn die ausgespielten Inhalte können jederzeit beliebig verändert werden.
Was Instore gerade erst beginnt, setzen andere Unternehmen (gemäß dem Motto: „Der Einkauf beginnt schon vor dem Laden“), bereits erfolgreich in ihrer Rundfunkwerbung ein. Sie platzieren darin Incentives, die den Kunden in die gewünschte Richtung statt zum Wettbewerber abbiegen lassen.
Bei alledem müssen die Kunden natürlich mitspielen. In aller Regel tun sie das auch, solange sie einen Gegenwert erhalten. Im Fall von Self-Scanning per Mobile sind Geschwindigkeitsgewinn, Transparenz und die Themen Gesundheit und Sicherheit, starke Akzeptanzbeschleuniger. Wenn der Kunde alle Funktionen in einem Produkt und dazu noch auf seinem eigenen Gerät findet, sind die Chancen für den stationären Handel gut, eine neue Ära des Einkaufens und des Marketings einzuläuten.
Next Step: Mobile Payment
Am Ende findet sogar das bisher ungeliebte Kind “Mobile Payment” seine sinnvolle Bestimmung im Self-Scanning: Wenn der gesamte Einkauf bereits mit dem Smartphone in der Hand passiert, ist das Bezahlen an der Kasse nur der prozesstechnisch logische, nächste Schritt. Es gibt mehr als genug Anbieter, die die Abwicklung dahinter liebend gerne übernehmen.
Dem Kunden ist es dabei übrigens herzlich egal, wer das Geld hinter den Kulissen transportiert. Für sie zählt nur die Durchgängigkeit. Daher ist es ein sinnvolles Feature für Self-Scanning Apps, dem Kunden auch die Möglichkeit einzuräumen, Zahlungen mit dem eigenen Device zu autorisieren.
Besser einbinden als unterbinden
Die Technik ist da, die Konzepte auch. Also eitel Sonnenschein? Können wir schon morgen alle mit dem Smartphone einkaufen und uns (und dem Handel) Zeit, Geld und Nerven sparen? Nicht ganz. Noch ist die Zeit der innovativen Händler, die den “Proof-of-Concept” im Realbetrieb für ihre Kollegen erbringen. Dies kostet zwar die eine oder andere Nervenzelle, birgt aber auch den Vorteil, sich heute schon dort zu platzieren, wo andere in fünf Jahren noch nicht sein werden: Nämlich weit vorne in der Sympathie der Kunden, die austauschbare Produkte dort kaufen, wo es am einfachsten ist.
Smartphones, Internet und der jederzeit mögliche Preisvergleich sind inzwischen auch im Alltag des Lebensmittelhandels angekommen. Als Teil seiner mobilen Strategie muss jeder Händler die Frage für sich beantworten, wie er mit der Nutzung von Smartphones bei sich im Laden umgehen will: Unterbinden oder einbinden?
Ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich zeigt die Chancen: In deutschen Museen ist den Besuchern das Abfotografieren der Exponate meist verboten, der Aufwand für die Durchsetzung des Verbots beträchtlich. Blicken wir zu unseren Nachbarn nach Frankreich, profitieren dortige Museen jedoch von der kostenlosen PR durch Selfies, Tweets und Whats-App Nachrichten: Sie ließen ihren Besuchern schlicht alle Freiheiten – Laissez-Faire.
Gleiches lässt sich auf den Retail-Bereich übertragen: Produkt- und Preisvergleiche lassen sich nicht vermeiden. Öffnet man den Kunden aber gleichzeitig die Möglichkeit, mit ihrem eigenen Gerät komfortabel und informiert einzukaufen und dann auch noch schnell durch die Kasse zu kommen, bekommt der stationäre Handel ein neues mächtiges Marketinginstrument. Ein Sprachrohr in der Tasche des Kunden – welcher Händler würde sich das nicht wünschen.
Über den Autor:
Nach seinem Bachelor-und Masterstudium der Medien & Kommunikation an der Hochschule Offenburg begann Marcus Ernst seine Tätigkeit als Leiter Sales & Marketing bei der Lahrer it-werke Gruppe. Sowohl in der Produktentwicklung wie auch -gestaltung mitentscheidend zeichnet Ernst seitdem für Lösungen wie mobiles Self-Scanning oder das patentierte Kommunikationsverfahren „Active Sounds“ verantwortlich. Seine Ideen und Konzepte stellte er auf verschiedenen Veranstaltungen als Speaker vor und schreibt heute über mobile Innovationen im Handel, Rundfunk und TV.
Bildquellen:
IT-Werke, Stocksnap.io







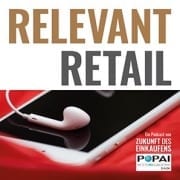



Trackbacks & Pingbacks
[…] Wie man den Checkout verbessern könnte, hat bei uns gerade Marcus Ernst von der it-werke Gruppe ausführlich beschrieben: Yes, we scan! Self-Scanning oder der Kunde ist der POS […]
[…] Self-Scanning am PoS bewegt in den letzten Jahren den Handel. Von einem Durchbruch kann keine Rede sein, obwohl die Vorteile auf allen Seiten überwiegen. […]
[…] Self-Scanning am PoS bewegt in den letzten Jahren den Handel. Von einem Durchbruch kann keine Rede sein, obwohl die Vorteile auf allen Seiten überwiegen. […]
Ihr Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie gern einen Kommentar!